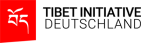China-Wissenschaftlerin Mareike Ohlberg erzählt von der Strategie der chinesischen Regierung, die Welt für Autokratien sicher zu machen. Im Interview spricht sie über die chinesische Strategie, das gegnerische Machtzentrum einzukesseln, um es zu erobern – über Chinas Einfluss bei uns.
VON ANJA OECK
Brennpunkt Tibet: Vielen Dank, Frau Ohlberg, dass Sie sich für dieses Interview Zeit nehmen. Gleich in medias res: Aristoteles hat in seiner „Politik“ die verschiedenen Gesellschaftssysteme beschrieben und gezeigt, wie eines – fast möchte man sagen zwingend – in das andere übergeht. Warum hält sich die Diktatur der Kommunistischen Partei (KPCh) in China so stabil?
Mareike Ohlberg: Hierzulande wurde lange Wandel durch Handel gepredigt: Wenn wir mit China Handel betreiben und die Menschen reicher werden, werden die Bürger irgendwann auf ihre Rechte pochen; das System wird sich öffnen und politisch reformieren müssen. Das war natürlich schon immer ein bisschen Wunschdenken bzw. auch ein Vorwand, um trotz massiver Menschenrechtsverletzungen weiter Handel mit China treiben zu können. Das größere Problem war aber, dass wir so getan haben, als wäre die KPCh in dem ganzen Geschehen nur ein passiver Beobachter. Tatsächlich aber hat sie vorgesorgt und gesellschaftliche Kontrollmechanismen etabliert, um genau so einen Systemwandel zu verhindern. Die Partei hatte hier den Vorteil, dass sie den Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks überlebt hatte und so quasi ab den frühen 1990er Jahren analysieren konnte, was sie tun musste, um einen Regimewandel im eigenen Land zu verhindern. Der Machtapparat der Partei richtet sich vor allem gegen horizontale Vernetzungen innerhalb der Zivilgesellschaft. Wenn Reform innerhalb der Machtstrukturen nicht möglich ist und sich eine Gesellschaft nicht außerhalb der von der Partei vorgegebenen Strukturen organisieren kann, kann sie auch nicht erfolgreich politische Reformen einfordern.
In Ihrem Buch beschreiben Sie ausführlich die Strategie der Chinesen, schleichend eine neue Weltordnung kreieren zu wollen. Können Sie die Bedeutung des Projekts „Neue Seidenstraße“ für Chinas Streben nach globaler Vorherrschaft erläutern?
Die chinesische Regierung stellt das Projekt gern als rein wirtschaftlich orientiertes Infrastruktur- und Konnektivitätsprojekt dar. Die Neue Seidenstraße hat selbstverständlich auch eine geopolitische Komponente. Länder sollen stärker an China gebunden werden, und zwar in einer Form, in der China die Grundbedingungen, zunehmend auch Standards und Normen, definiert. Durch die stärkeren Verflechtungen auf allen Ebenen sollen beteiligte Länder zudem in eine Position gebracht werden, dass sie im Fall eines Konfliktes zwischen China und einer anderen Macht zumindest neutral bleiben und idealerweise Chinas Seite ergreifen.
Inwieweit ist die KPCh die Voraussetzung für die chinesische Strategie nach geopolitscher Vorherrschaft?
Kishore Mahbubani schrieb vor Kurzem in der Financial Times, die Kommunistische Partei stehe als einzige zwischen der Welt und einem außer Kontrolle geratenen chinesischen Nationalismus. Würde eine demokratisch gewählte chinesische Regierung – getrieben von den Forderungen einer nationalistischen Bevölkerung – also möglicherweise ähnlich handeln wie China unter der Kommunistischen Partei? Kontrafaktische Fragen sind eigentlich immer unmöglich zu beantworten, jedoch hat die Partei genau diesen Nationalismus schon immer genährt, weil er Grundbestandteil der eigenen Legitimation ist: Bevor es uns gab, so die Partei-Narrative, wurde China gedemütigt; seit wir an der Macht sind, kann China der Welt die Stirn bieten. Das heißt nicht, dass es ohne die KPCh nicht auch nationalistische Menschen gäbe, die von der globalen Supermacht China träumen. Aber die Partei potenziert dies, statt es auszubremsen. Letztlich ist ein großer Teil der geopolitischen Strategie der Partei von dem Wunsch getrieben, die Welt neu zu ordnen, um sie für autokratische Regime wie sich selbst sicherer zu machen.
Ein großer Teil der geopolitischen Strategie der Partei ist von dem Wunsch getrieben, die Welt neu zu ordnen, um sie für autokratische Regime wie sich selbst sicherer zu machen.
Wie viel hängt davon am Führer Xi Jinping, wie viel an anderen Gremien oder Führungskadern?
Viele Menschen ziehen eine klare Linie zwischen der Partei vor und nach Xi Jinping. Vor Xi gab es für sie die Hoffnung, dass sich die Partei reformieren könnte; seit Xi hat sich China unter der Partei in ein totalitäres Land verwandelt. Fakt ist, dass die ideologischen Kontrollen und gesellschaftlichen Repressionen unter Xi noch einmal angezogen wurden. Xi hat sich viele Feinde gemacht; selbst einige Parteimitglieder können sich mit der Partei unter ihm nicht mehr identifizieren. Trotzdem war die Partei auch vor Xi keine Bastion der Bürgerrechte. Da gibt es einiges an institutioneller Kontinuität, das man nicht vernachlässigen sollte. Gerade was den internationalen Kurs der Partei betrifft, standen die Ziele schon länger fest, man hat nur jetzt, da China stärker geworden ist, mehr Möglichkeiten, sich durchzusetzen.
Gibt es eine Abfolge, in der nacheinander Länder und Kontinente bearbeitet oder bestimmte Methoden der Beeinflussung in einer bestimmten Reihenfolge angewendet werden?
Es gibt hier keine absoluten Regeln, und viel läuft natürlich parallel, aber ein Grundsatz der Partei lautet, „das Land nutzen, um die Stadt zu umzingeln“. Das heißt, man geht zuerst in die Peripherie, wo man es leichter hat, sich zu etablieren, und umzingelt von dort aus langsam „die Stadt“, also das Machtzentrum. Auf globaler Ebene sind die Entwicklungsländer „das Land“, das man zuerst versucht, auf die chinesische Seite zu ziehen, in Europa die kleineren Staaten. Ebenso versucht man, den Widerstand einer nationalen Regierung zu überwinden, indem man mit Lokalregierungen zusammenarbeitet. Dieses Einkesseln eines „Hauptfeindes“ bzw. des größten Kontrahenten ist ein Grundprinzip der Einheitsfrontarbeit der Partei.
Wie geht die KPCh mit ihren eigenen Landsleuten um?
Die KPCh geht mit den eigenen Landsleuten, die den Zielen der Partei im Wege stehen oder die als Gefahr für das Regime eingestuft werden, extrem brutal um. Menschen verschwinden einfach, und die Familien haben kaum eine Möglichkeit zu erfahren, was mit ihnen passiert ist. Inzwischen lernen auch immer mehr Menschen aus dem Westen die harte Seite der Partei kennen. Zum Beispiel drohte die chinesische Regierung dem Büroleiter des australischen Senders ABC damit, seine 14-jährige Tochter zu verhaften und an einem unbekannten Ort festzuhalten, wo man ihr, so deutete man an, Gewalt antun könnte. Am Ende konnten er und seine Familie doch noch ausreisen. Das meiste, was Menschen aus dem Westen in China widerfährt, ist immer noch relativ harmlos im Vergleich dazu, wie die KPCh mit Chinesen umgeht. In Minderheitenregionen wie Tibet und Xinjiang ist es wiederum noch schlimmer.
Welche Rolle spielen chinesische Großstädte und das chinesische Hinterland auf dem Weg zur globalen Vorherrschaft? Welche Rolle hat Tibet in dem Masterplan?
Die Neue Seidenstraße verläuft durch das chinesische Hinterland. Vor allem Xinjiang ist stark betroffen, wo über eine Million Menschen in Umerziehungslagern verschwunden sind. Im Vergleich dazu laufen weniger Routen direkt durch Tibet, trotzdem haben auch dort die Repressionen zugenommen. Zum Beispiel wurden über eine halbe Million Tibeter in „Trainingslager“ geschickt, um Chinesisch aber auch „Arbeitsdisziplin“ zu lernen, weil sie angeblich „faul“ seien. Das ist Teil der repressiven Minderheitenpolitik unter Xi und hat neben der Assimilation an die Han-chinesische Kultur auch das Ziel, Proteste gegen die Politik der KPCh direkt im Keim zu ersticken.

Wie funktioniert die Einflussnahme auf politischer Ebene und wie – was ja anscheinend noch stärker praktiziert wird – unterhalb von Staatspolitik und nationalem Einfluss, also auf Bundesland-Ebene oder bei Gemeinden und Einzelpersonen?
Die Partei pflegt eine sehr ausgeprägte Parteiendiplomatie. Die Internationale Abteilung der KPCh trifft sich mit allen großen und kleinen Parteien, die in irgendeiner Weise als relevant wahrgenommen werden. Der Vorteil ist, dass man jederzeit nicht nur mit der Regierung, sondern auch mit der Opposition in Kontakt ist. Zudem kann man junge Politiker für sich gewinnen, die später in wichtige Positionen aufrücken können. Auch die Lokaldiplomatie ist sehr ausgeprägt. Viele Länder pflegen Kontakte auf Stadtebene, allerdings ist die chinesische Seite häufig überrascht, wie wenig koordiniert das Ganze im Ausland abläuft. Lokaldiplomatie wird dann problematisch, wenn zum Beispiel wirtschaftliche Beziehungen genutzt werden, um Druck auf ausländische Partner auszuüben. Zum Beispiel werden Stadtregierungen hinter den Kulissen unter Druck gesetzt, sich nicht am Tag „Flagge zeigen für Tibet“ zu beteiligen oder sich in anderer Weise, die der chinesischen Regierung nicht passt, politisch zu engagieren.
Über Spionage in Konzernen wird ja immer wieder berichtet, Soft Power spricht sich auch so langsam rum. Welche chinesischen Einflussnahmen in Deutschland sehen Sie als besonders gefährlich oder unterschätzt an?
Aus meiner Sicht ist die Geschichte der chinesischen Einflussnahme in Deutschland relativ einfach. Zwar gibt es viele Netzwerke und immer wieder Versuche, Druck über formelle und informelle Kanäle auszuüben, und das klappt auch manchmal. Der wichtigste Faktor ist jedoch die Abhängigkeit der deutschen Automobilindustrie sowie einiger anderer großer Konzerne vom chinesischen Markt. Ich glaube, ich muss mich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, um zu behaupten: Wenn diese Abhängigkeit nicht existierte, dann sähe die deutsche China-Politik an vielen Stellen ganz anders aus.
Wie würden Sie die Sprache beschreiben, die China beim Werben um Austausch in den Partnerländern an den Tag legt?
Das Vokabular klingt immer sehr schön: Freundschaft, Austausch, kulturelle Brücken bauen, Win-Win-Kooperation. Die KPCh weiß, dass solche Worte ankommen, und deshalb nutzt sie sie auch. Davon sollten wir uns nicht blenden lassen. Das Wort “Freundschaft” ist ein politischer Begriff im leninistischen System – übersetzt vom russischen druzhba – und bezeichnet dementsprechend Personen, die bereit sind, für die Interessen der KPCh einzustehen.
Wie schätzen Sie den Einfluss westlicher Politiker auf das chinesische Regime ein?
Insgesamt begrenzt. Grundsätzlich ist es extrem schwierig, die KPCh dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie nicht will, vor allem, wenn es um strukturelle Änderungen wie die Öffnung der eigenen Wirtschaft oder das Aufgeben einer zentralen Politik geht. Trotzdem ermutige ich westliche Politiker immer wieder, Menschenrechtsverletzungen offen anzusprechen. Denn gerade bei Einzelfällen kann man durch laute Diplomatie viel bewirken.
Der wichtigste Faktor chinesischer Einflussnahme ist die Abhängigkeit der deutschen Automobilindustrie sowie einiger anderer großer Konzerne vom chinesischen Markt. Wenn diese Abhängigkeit nicht existierte, dann sähe die deutsche China-Politik an vielen Stellen ganz anders aus.
Ist das, was die Chinesen heute praktizieren, etwas anderes als das, was die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen haben, wobei sie nun gestört werden? Und wenn ja, worin unterscheiden sich die beiden Systeme in ihrem Ringen um die Weltherrschaft?
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde unter amerikanischer Besatzung Europa mit Hilfe des Marshall-Plans wieder aufgebaut, die europäische Zusammenarbeit wuchs. Die Neue Seidenstraße wird manchmal als „chinesischer Marshall-Plan“ bezeichnet, das halte ich aber für falsch. Der größte Unterschied, neben den Finanzierungskonditionen, die bei der Neuen Seidenstraße um einiges schlechter sind, ist, dass die USA tatsächlich ein großes Interesse daran hatten, Europa wieder aufzubauen, und bereit waren, dementsprechend zu investieren. Bei der Neuen Seidenstraße geht es China hingegen viel mehr um den Export von Überkapazitäten und um die Durchsetzung eigener, teils kleinteiliger Interessen durch die verstärkte Abhängigkeit von China. Mir geht es hier nicht darum, alles, was die USA international jemals getan haben, schönzureden, aber die Welt profitiert nicht von dem Rückzugskurs aus internationalen Organisationen und internationaler Verantwortung, den die Vereinigten Staaten derzeit unter Trump betreiben.
Ist es für uns Europäer nicht inzwischen normal, dass wir unter dem Einfluss der USA stehen, das zum Teil gar nicht mehr wahrnehmen und jedes andere – ungewohnte – Regime fürchten?
Gerade in Deutschland ist der Anti-Amerikanismus immer noch sehr stark ausgeprägt, so dass viele allein deswegen Russland oder China einen unverdienten Vertrauensvorschuss geben. Westeuropa, und allen voran Deutschland, machen es sich hier aus meiner Sicht etwas zu einfach. Wir leben unter einem Verteidigungsschirm der USA, verachten und verurteilen sie aber dafür. Wir sind wütend, wenn die USA ihre Truppen abziehen, aber gleichzeitig sind wir wiederum auch nicht bereit oder fähig, für die eigene Verteidigung aufzukommen oder auch nur moralische Verantwortung zu übernehmen. All das in Zeiten, in denen die Institutionen, die nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurden, langsam wegbröckeln oder von innen ausgehöhlt werden, nicht zuletzt, weil die USA sich zunehmend aus ihnen zurückziehen. Ich sehe mich bei dieser Debatte als Sinologin nicht unbedingt als erste Ansprechpartnerin. Dazu bräuchten wir mal eine ehrliche Auseinandersetzung. Hier würde es vielleicht schon reichen, wenn Deutschland die Bedenken seiner kleineren europäischen Nachbarn, wie den baltischen Staaten, grundsätzlich ein wenig ernster nehmen würde, wenn es um Russland oder auch China geht.
Dr. Mareike Ohlberg ist Senior Fellow im Asien-Programm des German Marshall Fund. Zuvor arbeitete sie beim Mercator Institute for China Studies (MERICS). Nach dem Studium der Ostasienwissenschaften an der Universität Heidelberg und der Columbia University, New York, promovierte Ohlberg über Chinas Außenpropaganda. Zu ihren Forschungsthemen hält sie zahlreiche Vorträge und veröffentlicht u.a. in der Wirtschaftswoche und der Neuen Zürcher Zeitung.
Last modified: 18. August 2022