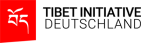Interview mit Roland Jahn, dem Mitbegründer der oppositionellen Bewegung „Friedensgemeinschaft Jena“ in der DDR und jetzigen Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen über seine Vergangenheit sowie über mögliche Impulse, die von der friedlichen Revolution in der DDR auf die heutige Situation der Tibeter in ihrem von China besetzten Land ausgehen können.

Herr Jahn, welche Parallelen sehen Sie bei den Schwierigkeiten der Tibeter heute im von China annektierten Tibet zu den Ihrigen in der ehemaligen DDR?
Ich bin nun kein expliziter Tibet-Kenner und kann keine direkten Bezüge setzen, aber was mir immer wieder deutlich wird, ist, dass es um grundsätzliche Fragestellungen geht, die weltweit eine Rolle spielen und die immer wieder aufzeigen, wie wichtig es ist, dass Menschen den Glauben an Freiheit und Selbstbestimmung nicht verlieren. Und mit der friedlichen Revolution haben wir in Deutschland ein Signal gesetzt, das weltweit zur Kenntnis genommen worden ist. Menschen haben in ihrem Drang nach Freiheit nicht aufgegeben und dafür gesorgt, dass die Mauer fällt. Das ist ein mutmachendes Symbol und kann Menschen in allen Ländern der Welt, wo Unterdrückung noch an der Tagesordnung ist, als Hoffnungszeichen dienen.
Die andere Parallele, die ich sehe, ist, dass es wichtig ist, dass unterdrückte Menschen nicht allein gelassen werden. Und da sehe ich schon Ähnlichkeiten zur heutigen Situation mit Tibet. Es sind meist nicht so viele, die gegenüber den Verantwortlichen des Unrechtes auch auftreten. In der aktuellen Politik ist die Auseinandersetzung mit Menschenrechtsverletzungen in China nicht an der Tagesordnung. Es wird business as usual gemacht, und natürlich ist es wichtig, dass es gute Kooperationen mit China gibt, aber mindestens genauso wichtig, dass man versucht, in kleinen Schritten den Menschen zu helfen, die unterdrückt werden. Und es gibt Fragestellungen, bei denen man unbedingt prinzipienfest sein muss und sich nicht dem Druck aus China beugen darf.
Wie haben Sie das gemacht, und wie sehen Sie das als praktizierbar, sich anzupassen und zu rebellieren? Wenn das immer ein Gemisch ist, wie auch in Ihrem Buch „Wir Angepassten. Überleben in der DDR“ beschrieben, wie entscheide ich dann im einzelnen Moment, was zu tun ist?
Da gibt es keinen allgemeinen Maßstab. Es besteht immer die Gefahr, dass man mit dem Kopf gegen die Wand rennt und am Ende auf der Strecke bleibt, weil einen die Repression kaputtspielt, sowohl seelisch als auch körperlich. Es ist also immer ein Abwägungsprozess, was für ein Schaden eintritt, für mich persönlich, aber auch für die Familie, für Freunde und für die gesamte Situation. Also es ist wichtig, dass man sich manchmal taktisch verhält, auch wenn es darum geht, Mitstreiter zu gewinnen. Mit radikalen Positionen ist man oft einsam, verliert die Möglichkeit, sich gemeinsam Mut zu machen und für Menschenrechte einzutreten. Aber die Taktik darf nicht dazu übergehen, dass man sich selber aufgibt, dass man seine Ideale verrät. Das sind schwierige Entscheidungen.
In der Hinsicht sind die Erfahrungen, die wir in der DDR gesammelt haben, wichtig: sie weiter zu vermitteln, zum Beispiel den Streit zwischen Leuten, die in der DDR die Niederschlagung des Volksaufstands 1953 erlebt haben, wo am Ende die sowjetischen Panzer alles niedergewalzt haben, und jüngeren Leuten, die nicht von diesem Ereignis geprägt waren. Die haben einen radikaleren Weg gewählt. Am Ende kommt es darauf an, sich gegenseitig zu verstehen und keine Vorwürfe zu machen, dass jeder für sich entscheiden darf, inwieweit er Protest anmeldet und wie radikal er das tut.
Ich habe im Nachhinein gemerkt – eine ganz persönliche Sache – dass wir oft zu klein gedacht haben, dass wir froh waren, wenn wir uns kleine Freiheiten erkämpft hatten, aber dass wir beispielsweise das ganze Grenzsystem der DDR einfach hingenommen haben. Wir hätten eigentlich jeden Tag in Berlin demonstrieren müssen gegen das, was diese Mauer ausdrückt, die Unterdrückung der ganzen Bevölkerung nämlich und die Bereitschaft dieses Systems, auf Menschen zu schießen wie auf Hasen.
Ich maße mir aber nicht an, Widerstand von anderen einzufordern. Es ist immer die Frage: Wie kann man Angst überwinden, und wie, Menschen dazu bringen, dass sie gemeinsam die Kraft entwickeln sich dagegenzustellen. Das ist auch die Lehre aus 1989. Es hat in Leipzig und anderswo mit wenigen Demonstranten angefangen. Es wurden Leute weggefangen. Der Staat hat sich Einzelne herausgepickt und die Repression so angewandt, dass es Wirkung hatte. Aber als es 70.000 waren, war das nicht mehr so einfach. Diese Entwicklung vom Einzel- zum Massenprotest hat damit zu tun, dass Menschen ihre Angst verlieren und eine Gemeinschaft bilden, die so viel Kraft hat, dass man offen auftritt gegen das System.
Da sind Sie genau bei meiner nächsten Frage angelangt: Wie kann man eine so übermächtige Diktatur stürzen? Welche Zutaten und Gegebenheiten braucht es, damit so etwas gelingt?
Man sollte sich vor Verallgemeinerungen hüten, auch davor, Erfahrungen aus dem einen Land direkt auf das andere zu übertragen. Es geht eher darum die Erfahrungen zur Kenntnis zu nehmen und zu schauen, was man für sich daraus nutzen kann. Oft ist es die Hoffnung, die man mitnimmt. Aber in den Einzelfragen: Wie verhält man sich? Wann ist was taktisch angemessen, um einen Prozess voranzutreiben? Das ist sowohl von der speziellen Situation abhängig, als auch von den Menschen, wie sie ihre Haltung umsetzen können. Da etwa einzufordern: „Schau, die haben es damals so gemacht, Ihr könnt es doch auch so machen!“, das geht nicht.
Ein revolutionärer Prozess hat mit extrem vielen Faktoren zu tun. Wenn ich das auf die DDR und die friedliche Revolution beziehe, gab es da viele Akteure, bestimmte Rahmenbedingungen, die bestimmte Freiräume geschaffen haben. Wenn ich allein die Entwicklung der Sowjetunion unter Gorbatschow anschaue, oder die Entwicklung in Osteuropa: Solidarnosc in Polen oder die Reformen der kommunistischen Partei in Ungarn, das alles sind Entwicklungen, die Einfluss genommen haben. Und natürlich in der DDR: die Ausreisebewegungen, die Diskussionen in den verschiedenen Oppositionsgruppen… Wenn nur ein Faktor gefehlt hätte oder ein anderer dazu gekommen wäre, hätte alles anders verlaufen können. Wenn einer der Polizisten bei den Massendemonstrationen durchgedreht wäre und geschossen hätte, dann wissen wir nicht, wie es ausgegangen wäre.
Das Entscheidende ist für mich: Der Freiheitswille von Menschen ist nicht auf Dauer unterdrückbar. Menschen sind dazu geboren, frei zu sein. Und die Menschenrechte sind die Basis des Zusammenlebens, sowohl national als auch international.
Roland Jahn
Das Entscheidende ist, dass dieser Freiheitsdrang irgendwann aufbricht. Man kann Rahmenbedingungen schaffen, damit der Freiheitsdrang sich Bahn brechen kann. Das heißt: international immer wieder Menschenrechte anzumahnen, in der Staatengemeinschaft darauf zu achten, dass die Menschenrechte zählen, auch wenn man sich in allen anderen Fragen durchaus streiten kann.
Und wie sehen Sie die Lage der Tibeter heute, wenn Sie sich da ein Urteil erlauben wollen?
Davor hüte ich mich, ich stecke nicht tief genug in der Materie. Ich erfahre wie jeder Bundesbürger hin und wieder etwas und bin erschrocken über die Nachrichten. Es ist wichtig, dass wir Informationen darüber bekommen, was an Unrecht und an Menschenrechtsverletzungen geschieht. Auch das beschreibt eine Diktatur, dass sie versucht, Informationen zu unterdrücken. Was man erfährt ist schockierend, in welcher Art und Weise ein System friedfertige Menschen oder einzelne Menschengruppen unterdrückt werden. Und das in Zeiten, wo die Völkergemeinschaft eigentlich viele große Herausforderungen hat, bei denen man gemeinsam an einem Strang ziehen müsste und die Unterdrückung von Menschen eigentlich der Vergangenheit angehören sollte.
Wie schätzen Sie das Potenzial der Proteste jetzt in Hongkong ein?
Auch Hongkong zeigt, welche Gefahren bestehen, wenn man einem kommunistischen System gegenüber zu gutgläubig ist, man zum Beispiel denkt, in einem Land mit zwei Systemen leben zu können. Das ist naiv. Ich denke, damit wird verkannt, dass die kommunistische Ideologie menschenfeindlich ist, obwohl sie genau das Gegenteil vorgibt. Wenn das Individuum unterdrückt wird, um für eine Partei die Macht zu stützen, steht das komplett im Gegensatz zum Ansatz einer liberalen, demokratischen Gesellschaft.
Ein Land mit zwei Systemen funktioniert nicht, zumindest nicht, wenn eines ein kommunistisches ist.
Roland Jahn
Gerade in Hongkong zeigt sich für mich auch, dass die Weltgemeinschaft diese Drohgebärden von China und die Gewalt gegen Demonstranten nicht hinnehmen kann. Allein der Gedanke an das Vorhaben, Menschen an das kommunistische China auszuliefern, kann nicht hingenommen werden. Hier geht es um die Grundwerte der Demokratie: Rechtsstaatlichkeit, die Selbstbestimmung sowohl des Individuums als auch von Menschengruppen. Das sind wesentliche Elemente, die verankert sein müssen.
Demokratie selbst ist ein Prozess, den es weiterzuentwickeln gilt, und immer wieder muss die Partizipation der Menschen gewährleistet werden. Die Qualität einer Demokratie erkennt man auch daran, wie sie mit Minderheiten umgeht, dass sich eine Mehrheit nicht einfach über eine Minderheit hinwegsetzen kann. Das wäre dann keine Demokratie. Demokratie heißt, dass die verschiedenen Interessen eines Volkes mit zum Tragen kommen. Deswegen sind Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit die Grundlagen dafür, dass Demokratie funktionieren kann.
Das bedeutet dann auch längere Konflikte und Auseinandersetzungen…
Richtig, aber die Grundrechte sind die Voraussetzungen dafür, dass diese Konflikte in einer Art und Weise geführt werden, dass die Menschenwürde geachtet wird. Achtung der Menschenwürde, Grundrechte, Meinungsfreiheit, Presse- und Informationsfreiheit müssen gesichert sein, damit Demokratie überhaupt lebendig gestaltet werden kann.
Würden Sie sagen, dass ein kommunistisches System per se die Potenziale Einzelner nicht nur kappt, sondern, weil alles systemtreu sein soll, sogar verhindert?
Ich denke schon, dass die Geschichte bewiesen hat, dass die kommunistische Ideologie menschenverachtend ist, weil kein demokratischer Prozess gestaltet wird. Wir haben in der DDR gewitzelt: „Für die DDR gilt, im Mittelpunkt steht der Mensch, aber nicht der Einzelne.“
Sie meinen, der Mensch als Abstraktum…
Ja. Das ist so bezeichnend. Man hat sozusagen vorgegeben man sei eine menschliche Gesellschaft, und der Mensch als Abstraktum stehe im Mittelpunkt. Aber konkret hieß das, dass der Einzelne, das Individuum missachtet wurde. Für mich ist es in einer demokratischen Gesellschaft genau andersherum: Nur die Achtung des Individuums kann im Ergebnis dazu führen, dass der Mensch insgesamt geachtet wird. Oder: Man hat in der DDR immer vorgegeben, dass alles getan wurde, um die Menschenrechte zu schützen, aber so einfach die Aussage klingt: Man kann Menschenrechte nicht mit Menschenrechtsverletzungen schützen.
Allein das Grenzsystem der DDR, das „Bollwerk für den Frieden“, ein „antifaschistischer Schutzwall“ ist ein Unding. Angeblich wollte man den Sozialismus damit in Ruhe aufbauen können für eine menschengerechte Gesellschaft. Aber allein die Existenz dieser Mauer hat gezeigt, dass man Menschenrechtsverletzungen begeht, um so dann angeblich Menschenrechte zu schützen. Dieser Widerspruch zeigt, dass das nur Propaganda und am Ende menschenverachtend war. In der Hinsicht machen die konkreten Erfahrungen aus der DDR deutlich: Der Maßstab der Menschenrechte ist ein allgemeingültiger, auf den man sich in der Welt geeinigt hatte. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist eine Grundlage, auf der man alle Auseinandersetzungen führen kann, auch die, wie eine Gesellschaft zu gestalten ist. Und letztlich bin ich erschrocken, wie viele Menschen dem Sozialismus und Kommunismus geglaubt haben, mich mit einbezogen, gedacht haben, der Sozialismus könne eine gerechte Gesellschaft verwirklichen. Wenn man sich die Verfassung der DDR anschaut, in der festgeschrieben ist, dass eine Partei die führende Rolle hat, kann das zu keiner gerechten Gesellschaft führen.
Zu glauben, dass man sich abschotten kann…
Genau, das sind Gruppenegoismen, die immer wieder deutlich machen: Das Individuum bleibt auf der Strecke. Und wer das Individuum, die Würde des einzelnen Menschen nicht achtet, wird mit seinem Gesellschaftssystem scheitern, weil Individuen auf Dauer immer wieder nach Freiheit und Respekt streben werden.
Mich hat erschrocken, als ich erfahren habe, dass heute kein chinesischer Protest mehr existiert. Es gibt kaum noch Gruppen, die in China wirklich opponieren.
Ja, es ist natürlich nicht einfach, gerade wenn die wirtschaftliche Entwicklung einigermaßen floriert, wenn Menschen über den Konsum in das System mit eingebunden werden. Das habe ich auch in der DDR gespürt, das kleine Glück, mit dem man schon zufrieden war.
So lang in Gesellschaften die Menschen noch an Mercedes, Eigenheim und andere materielle Anreize glauben, weil sie sie bisher nicht hatten, ist es relativ einfach, sie zu motivieren staatsgläubig zu sein. Wenn das dann aber erfüllt ist, wenn materielle Anreize also nicht mehr ziehen, was kommt dann? Dann kann man sie damit nicht mehr korrumpieren.
Das ist in der DDR auch so gewesen, dass sich viele junge Menschen in den letzten Jahren der DDR die Frage gestellt haben: Was ist der Sinn meines Lebens? Ist es das Materielle, ist es etwas, womit ich mich verwirklichen kann? Und da sind viele zu der Erkenntnis gekommen, dass sie etwas anderes wollen, als das, was sie in der DDR vorfanden. Natürlich sind die besonderen Bedingungen in Deutschland hier von Bedeutung, weil, vor Augen zu haben, was im anderen Teil geschieht, das war immer ein besonderer Spiegel. Wenn man zum Beispiel durch Osteuropa gereist ist und Westdeutsche getroffen hat – und ich selber habe es in den 70er Jahren erlebt – dass die einen an der bulgarischen Grenze Halt machen mussten und die Freunde aus dem Westen weitergetrampt sind durch die Türkei bis nach Afghanistan.
Diesen Gedanken des Eingesperrtseins hat man als Jugendlicher konkret wahrgenommen. Auch wenn die Leute Westfernsehen geschaut und Westrundfunk gehört haben: Manche wollten einfach mal die Stones live erleben, nicht nur im Radio. Oder die Frage, was darf ich studieren, wo muss ich mich unterordnen mit meiner Meinung, sie nicht sagen? Es waren ganz einfache Bedürfnisse. Eine geschlossene Gesellschaft wird auf Dauer krank. Es haben dann mehr und mehr Menschen versucht, sich von dieser Krankheit zu befreien und sich einen Weg zu einem menschlicheren Leben zu suchen.
Wie kam denn die Friedensgemeinschaft in Jena zustande? Waren es Einzelne?
Ausgangspunkt war natürlich schon der Drang nach Selbstbestimmung, einfach sein Ding zu machen und sich Freiräume zu schaffen, sich zusammenzufinden, sich ein schönes Leben mit Freunden zu machen. Immer wieder aber auch, wo man an Grenzen gestoßen ist, Freiräume zu erweitern und sich zu verwirklichen. Und so hat man Gleichgesinnte gefunden, die genauso dachten.
Aus welchen Zirkeln kamen die, aus der Kirche, aus der Kultur, von der Uni …?
Nein, das ist in einer Stadt von 100.000 Einwohnern einfacher: Da läuft man sich eher über den Weg, bei Musikveranstaltungen, an der Straße beim Trampen und ist auch in der Öffentlichkeit mit anderen im Austausch. Und plötzlich merkt man: „Der denkt ja so wie Du. Der hat ja die gleichen Alltagssorgen im Betrieb, an der Uni und sonstwo.“ Und so hat sich in Jena eine Szene herausgebildet, die ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt hat. Das war auch oft unpolitisch. Da wurden Partys gefeiert, da ging man gemeinsam wandern. Aber es wurde immer wieder an den Punkten politisch, wo der Staat die Freiräume eingeschränkt hat. Wenn Menschen Nachteile hatten – von der Schule geworfen, von der Uni exmatrikuliert oder auch ins Gefängnis gesperrt wurden – hat das immer mehr zusammengeschweißt. Dieser Staat hat sich seine Staatsfeinde selbst geschaffen und dafür gesorgt, dass die Menschen als Gruppe zusammengewachsen sind.
Die Gründung der Friedensgemeinschaft Jena war eine Folge davon, konkret, unabhängig von der Kirche. Sich als Gruppe zu verstehen, hatte auch mit der Verhaftungswelle 1982 zu tun, wo eine ganze Gruppe von Jugendlichen ins Gefängnis kam. Nach Protesten im Westen gab es auch Proteste in der DDR, woraufhin wir alle entlassen wurden. Unsere Reaktion: „Jetzt erst recht! Jetzt fühlen wir uns als Gruppe, die eine friedliche Gesellschaft will“. Und dann haben wir uns „Friedensgemeinschaft Jena“ genannt. Natürlich war das eine Menschenrechtsgruppe und der Begriff „Friedensgemeinschaft“ war ein taktischer, weil wir damit auch denjenigen ein Angebot machen wollten, die sich nicht so radikal dem Staat gegenüber positionieren wollten. Wir dachten, das Angebot, an einer friedlichen Gesellschaft mitzuarbeiten, wäre für viele erstrebenswert.
Da gab es ja auch schon die Ausbürgerungen von Wolf Biermann… und den mysteriösen Tod von Matthias Domaschk im Untersuchungsgefängnis.
Richtig, auch das war ein Entwicklungsprozess, der über Jahre hinweg ging. Man kann das ab der Gründung der DDR sehen, was sukzessive vonstatten ging mit einzelnen Rückschlägen, wie zum Beispiel 1953 oder 1968 – 68 war ja nicht nur der Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in der Tschechoslowakei, sondern 68 hieß auch, dass Leute, die den Reformkurs in der Tschechoslowakei unterstützt hatten, ins Gefängnis wanderten, gerade junge Leute. Damit wurde eine Zäsur gesetzt: Dem Traum von einer gerechteren Welt, in der Art, wie er auch in osteuropäischen Staaten lang geträumt wurde, begegnete man mit Panzern. Dann natürlich der KSZE-Prozess (Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit) in Europa, an dem die DDR beteiligt war: Das gab Hoffnung, wirkte wie eine Chance, dass sich die DDR an internationale Regeln hält, dass Menschenrechte gewährleistet würden.
Aber dann kam ein Jahr später schon die Zäsur mit der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann und dem Aderlass der Schriftsteller und Künstler. Das hat ernüchtert. Dieser Prozess ging immer weiter, mit Verhaftungen speziell auch von Einzelpersonen an Orten, die nicht so bekannt waren. In Berlin wurde nicht so schnell verhaftet, weil die Stadt immer im internationalen Fokus stand, während man in anderen Orten eher zuschlug, und die Leute ins Gefängnis sperrte für Dinge, die man in Berlin durchgehen ließ. In dieser Situation entstand in der DDR mit zunehmender Vernetzung eine Oppositionsbewegung, in der man die Gedanken für eine freie, selbstbestimmte Gesellschaft weitergetragen und sich gegenseitig Mut gemacht hat. Und trotzdem waren es in den 70er und 80er Jahren nur relativ wenige, die sich konsequent gegen diesen Staat stellten, die bleiben wollten, um zu verändern, und den Traum von Freiheit und Selbstbestimmung nicht aufgaben. Aber natürlich hatte auch jeder Weggang aus der DDR, um Freiheit anderswo zu suchen, eine destabilisierende Wirkung und war ein wichtiger Ausdruck gegen den Staat.
Sie wollten die DDR ja nicht unbedingt verlassen..
Ja, aber man darf das eine nicht gegen das andere ausspielen. Es ist immer ein selbstbestimmtes Leben, das man möchte. Und es gilt, die Haltung gegenseitig zu respektieren. Für den einen ist es nicht so einfach wegzugehen, wegen Heimat, Familie und Freunden, die man nicht aufgeben möchte. Für den anderen ist es nicht mehr zu ertragen gewesen, wenn schon Kinder in der Schule sozialistischen Drill erleben mussten. Dann war auch der Weggang ein Ausdruck von Verantwortung gegenüber der Familie.
Würden Sie sagen, an Ihrer Haltung und Arbeit, nachdem Sie ausgewiesen wurden, hat sich etwas verändert? Oder war es konsequent zum Beispiel für die ARD zu arbeiten? War Ihre Haltung die gleiche wie davor?
Es sind immer Entwicklungsprozesse. Ich war inzwischen an einem Punkt, dass ich nicht mehr an die Reformierbarkeit des Sozialismus glauben konnte, sondern erkannte: „Dieser Staat ist nicht mein Staat“. Trotzdem dachte ich: „Ich kann meine Heimat nicht der SED überlassen, sondern möchte, dass sich in diesem Land etwas grundlegend ändert. Nicht aber, dass die SED an der Macht bleibt und mit Zugeständnissen an die Bevölkerung versucht, Veränderung zu verhindern.“ Aber spätestens nach meiner gewaltsamen Ausbürgerung habe ich gemerkt, dass der Weg mit zwei deutschen Staaten und unterschiedlichen Systemen nicht funktioniert. Ich wusste, dass ich meine innere Zerrissenheit als Ost- und Westdeutscher nur auflösen konnte, wenn es zu einem einheitlichen Deutschland kommt.
Würden Sie sagen, dass Sie als Journalist so etwas wie bearing witness betrieben haben, indem Sie gezeigt haben, was in der DDR schief lief?
Für mich waren die Möglichkeiten, nach meiner Ausbürgerung in den Westen, eine große Chance, die Opposition in der DDR zu unterstützen. Ich konnte frei agieren, indem ich versuchte, Informationen in die DDR zu bringen, angefangen von Büchern, Zeitungen, bis dazu, dass ich bei Rundfunk und Fernsehen arbeitete. So habe ich für freie Informationen in der DDR gesorgt, habe der Opposition in der DDR eine Stimme gegeben und immer wieder die Pluralität der Meinungen angefacht. Es ging darum, den gesellschaftlichen Diskurs in der DDR zu fördern, ein Stück Freiheit zu befördern, freie Informationen und einen freien Diskurs zu ermöglichen und nicht auf die Freiheit zu warten.
Das hat vorausgesetzt, dass Sie auch Informanten in der DDR hatten, die Ihnen Informationen schickten, so dass Sie das Westfernsehen bestücken, und dies zurück in die DDR tragen konnten.
Deswegen ist es so wichtig, dass überall auf der Welt, wo Menschen unterdrückt werden, sie von außen Unterstützung haben. Genauso, dass die Welt davon erfährt, was für ein Unrecht geschieht, aber auch, dass Vernetzung innerhalb eines Landes, in dem Repression herrscht, durch die Hilfe von außen erfolgt. Freie Informationen sind ganz wichtig, die Mut machen, sich zu wehren. Wenn das Informationsmonopol der Diktatur gebrochen wird, dann gerät eine wichtige Säule der Diktatur ins Wackeln.
Und das kann man wieder auch auf Tibet übertagen. Mir gefällt es sehr, dass Sie in Ihrem Buch „Wir Angepassten, Überleben in der DDR“ die Täter-Opfer-Dichotomie versuchen aufzulösen, zu zeigen, dass dieses einfache Schwarz-weiß-Denken nicht funktioniert.
Wir kommen ja zu keiner Erkenntnis, wenn wir von vornherein mit Schuldzuweisung arbeiten. Es ist wichtig, selbst zu erkennen, wie das System funktioniert hat, wie gefangen wir alle in dem System waren. Das zu begreifen ist schwierig und kann nur geschehen, indem wir offen reden, indem wir mit unserer eigenen Verantwortung umgehen und von diesen Schubladen von Täter und Opfer wegkommen.
Wie sehen Sie die Grenzen in unserem westlichen System heute? Werden wir nicht nach amerikanischem Vorbild durch Konsum, Ablenkung und Zerstreuung am Zu-uns-Kommen und Nachdenken gehindert?
Die wichtigen Voraussetzungen sind Grund- und Menschenrechte, die uns möglich machen, einen gesellschaftlichen Diskurs über den besten Weg zu führen. Und in der Hinsicht haben wir hier gute Voraussetzungen. Es ist immer eine Herausforderung, diese Demokratie weiterzuentwickeln, verschiedene gesellschaftliche Interessen und Blickwinkel zu berücksichtigen. Demokratie ist anstrengend. Wie viel Freiheit darf man einschränken, um Freiheit zu schützen, oder, um die Welt, die Natur zu schützen? Manche wünschen sich eine Ökodiktatur, manche wünschen sich klarere Verhältnisse, um sich vor Terrorismus zu schützen. Und da ist es immer ein Abwägungsprozess, welche Instrumente eingesetzt werden, um bestimmte Werte unserer Gesellschaft zu erhalten. Diesen Diskurs gilt es bestmöglich zu führen. Und das beginnt bei der Würde des Einzelnen, weil auch dieser Diskurs nur respektvoll geführt werden kann, nicht mit Beschimpfung und Ausgrenzung.
Lieber Roland Jahn, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und das Gespräch.
// Das Interview führte Anja Oeck, Chefredaktion ‚Brennpunkt Tibet‚
Das könnte Sie auch interessieren:
Last modified: 9. November 2019