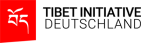Jampa Kalsang Phukhang Rinpoche, Gründungsmitglied der Tibet Initiative Deutschland, blickt im Interview mit Wilhelm Maassen zurück auf die Anfänge der Tibet-Bewegung in Deuschland und auf die Perspektiven für ein freies Tibet.

Jampa Kalsang Phukhang Rinpoche ist Tibetologe, Autor und Gründungsmitglied der Tibet Initiative Deutschland (TID). 1942 in Tibet geboren, studierte er bis zu seiner Flucht nach Indien im Jahr 1959 im Kloster Ganden, einem berühmten Kloster der Gelug-Schule des tibetischen Buddhismus.
Als sich die Universität Bonn 1963 über die deutsche Botschaft in Neu-Delhi bei der tibetischen Exilregierung nach einem Lektor für Tibetisch erkundigte, schickte der Dalai Lama drei Kandidaten nach Neu Delhi. Ausgewählt wurde Jampa Kalsang Phukhang Rinpoche. An der Universität Bonn arbeitete er bis zu seiner Pensionierung 2006 als Lektor.
2019 feierte die Tibet Initiative Deutschland (TID) ihr 30-jähriges Jubiläum. Was hat die TID in diesen 30 Jahren erreicht?
Die TID gründete sich damals auf die Initiative unseres „Vereins der Tibeter in Deutschland“ (VTD) und hat viel erreicht – genau wie wir es uns gewünscht haben. Durch Einflussnahme auf Medien und durch öffentliche Veranstaltungen wurden z. B. die politische Situation, die Menschenrechtsverletzungen und die Lage der politischen Gefangenen in Tibet bekannt gemacht.
Zudem werden immer wieder Bundestagsabgeordnete kontaktiert und über die Situation in Tibet informiert. Und Unterschriftensammlungen zur Freilassung politisch Gefangener führten für viele Inhaftierte zur Wiedererlangung ihrer Freiheit.
Blicken wir zurück auf das Gründungsjahr 1989: Wie kam es zur Gründung der Tibet Initiative?
Schon Anfang der 80er Jahre wollten wir, der VTD, eine Organisation gründen, die uns politisch aktiv unterstützt. Bei der Gründung dieser Organisation ergaben sich jedoch immer wieder Hindernisse.
Am 10. März 1989 kamen dann etwa 800 Menschen zu einer unserer öffentlichen Veranstaltungen mit Fotoausstellung und Vortrag in Bonn. Im Anschluss wurden wir von vielen Zuhörern gefragt, wie sie uns unterstützen können. Spontan legten wir eine Liste aus, in die sich 80 Interessenten eintrugen.
Und aus diesen Interessenten heraus rekrutierten sich die Gründungsmitglieder?
Von den 80 Personen folgten 30 unserer Einladung nach Hennef-Uckerath am 8. April 1989. Zu dem Treffen, das von unserem Vorstandsvorsitzenden Dr. Palden Tawo geleitet wurde, kamen unter anderem Kelsang Gyaltsen, der damals Vertreter des Dalai Lama in Europa war, der Filmemacher Clemens Kuby und ein Grünen-Politiker aus Köln.
Alle waren sich darüber einig, dass ein politischer Verein gegründet werden sollte. Ein Name wurde jedoch noch nicht gefunden, daher wurde die Klärung dieser Frage auf einen späteren Zeitpunkt vertagt.
Und wann wurde die TID dann „offiziell“?
Die offizielle Gründung der Tibet Initiative Deutschland wurde mit einer feierlichen Zeremonie am 8. August 1989 in Bonn begangen. Hierzu fanden sich in der Wohnung von Birgit Arens sieben Deutsche und sechs Tibeter zusammen.
Zu Beginn war alles noch recht provisorisch: Die Vereinstreffen fanden zunächst in dieser Wohnung statt, bis die Geschäftsstelle 1994 nach Essen verlegt wurde. Helga Fuhrmann übernahm bis dahin die Büroarbeiten.
Welches halten Sie für das wichtigste Ziel der TID?
Fast alle Tibeter haben ein Ziel im Visier: eine politische Lösung für ihre Heimat herbeizuführen. Das sollte letztlich auch das Ziel der TID sein. Und es gibt durchaus Entwicklungen in Tibet, die uns Hoffnung machen. So führen heute viele junge Tibeterinnen und Tibeter, die unter der chinesisch-kommunistischen Erziehung großgeworden sind, den Widerstand an.
Insgesamt hat das politische Bewusstsein der Tibeter in den letzten 20 Jahren eine noch nie dagewesene Reife und Entschlossenheit erreicht, vor allem nachdem 2008 die Proteste in Tibet blutig niedergeschlagen wurden. Trotz dieser Entschlossenheit haben die Tibeter ihren Weg der Gewaltlosigkeit nicht verlassen.
Worauf begründet sich das Streben der Tibeter nach Selbstbestimmung und Autonomie?
Tibets Geschichte reicht zurück bis ins Jahr 127 v. Chr. Damals vereinte der erste König Tibets, Nyatri Tsanpo, die verschiedenen Stämme im tibetischen Hochland zu einer Nation.
Die tibetische Sprache gehört zur tibeto-burmesischen Sprachengruppe und ist völlig eigenständig. Abgesehen von chinesischen Lehnwörtern und den Mantras auf Sanskrit hat das Tibetische keine Verwandtschaft mit anderen Sprachen.
Daher fordern wir eine echte Autonomie, um unsere Sprache, Kultur und Religion erhalten und pflegen – und damit die Identität des tibetischen Volkes bewahren zu können.
Ihr 30-jähriges Jubiläum stellte die TID unter das Motto: „Der Traum lebt“. Was ist notwendig, damit der Traum von einem freien Tibet eines Tages Wirklichkeit wird?
Die VR China hat 1951 mit Tibet einen Vertrag geschlossen: das sogenannte „17-Punkte-Abkommen“. Darin verpflichtet sie sich, Tibet einen Sonderstatus einzuräumen. Seither ringt die tibetische Exilregierung darum, dass dieser Sonderstatus umgesetzt wird.
Wie 1960 von der internationalen Juristenkommission in Genf festgestellt wurde, lagen bis 1950 in Tibet alle drei Kriterien für einen selbständigen Staat vor: nämlich ein Volk, ein Gebiet und eine innerhalb des Gebietes funktionierende Regierung.
Woran scheitern dann die Autonomie-Bestrebungen bislang?
Deng Xiaoping, der Nachfolger nach Maos Tod, führte Gespräche mit der tibetischen Exilregierung. Er äußerte, man könne über alles reden, außer über Unabhängigkeit. Damals gab es Verhandlungen zwischen China und der tibetischen Exilregierung, der Dalai Lama entsandte mehrere Delegationen nach Peking.
Zwischenzeitlich waren die Kontakte unterbrochen, seit einiger Zeit werden jedoch wieder Verbindungen aufgebaut. Der Traum der Tibeter, also echte Autonomie zu erlangen, wird vom Dalai Lama mit dem „Mittleren Weg“ verfolgt.
Wie sieht dieser Weg aus?
Der „Mittlere Weg“ bedeutet echte Autonomie für das gesamte tibetische Gebiet, nämlich für Zentral-Tibet, für Kham und für Amdo. Im Gegenzug verzichten die Tibeter auf einen unabhängigen Staat und bleiben im chinesischen Staatenbund. Außenpolitik, Verteidigungspolitik etc. würden also in Chinas Verantwortung bleiben.
Dieses Modell hat sich an anderer Stelle bereits bewährt, ein europäisches Vorbild ist etwa Südtirol. Selbst bei den Chinesen findet dieser Vorschlag immer mehr Unterstützung. Je mehr man also über den „Mittleren Weg“ des Dalai Lama nachdenkt, umso einleuchtender und vernünftiger wird er.
Das Interview führte Wilhelm Maassen / Regionalgruppe Köln/Bonn
Last modified: 8. Januar 2020